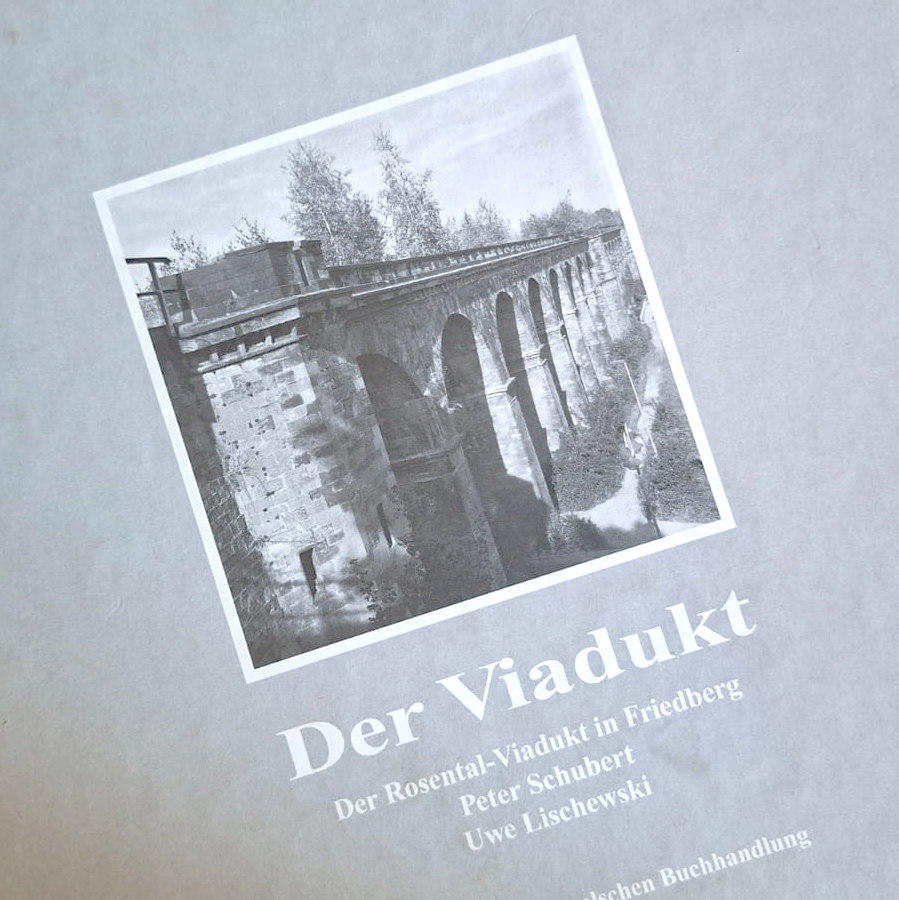Auch mit Friedrich Weinbrenners bedeutendem Schüler Georg Moller beschäftigen wir uns zunehmend. Nicht nur seine Architektur, auch sein Berufsverständnis verdankt der jahrzehntelange hessische Baudirektor zu einem großen Teil seinem Karlsruher Lehrer und lebenslangen Freund. Und auch in seinem Werk gibt es offene, spannende Fragen.
Deshalb sind wir gerne der Bitte nachgekommen, Stellung dazu zu beziehen, ob wohl das gewaltige Rosental-Viadukt, ein monumentales Pionierwerk der frühen Eisenbahnkonstruktionen, als Werk Georg Mollers gelten darf. Nun ist auch hier unser Gutachten in ganzer Länge nachzulesen. Dabei half neben unseren eigenen Forschungen das grundlegende Buch "Der Viadukt" von Peter Schubert aus dem Jahr 1995.
Der Rosental-Viadukt in Friedberg
Zur Frage der Autorenschaft und Einordnung
Fragestellung und Zielsetzung
Die 275 Meter lange Eisenbahnbrücke auf den bis zu sechzehn Meter hohen Steinbögen gehört zu den eindrucksvollen Zeugnissen der Industriekultur rund um die damals neuen Bahnverbindungen, hier des Abschnitts der Main-Weser-Bahn von Friedberg auf dem Weg nach Bad Nauheim. 1847–50 gebaut, mithin noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und erst kurz nach der Einführung des neuen Fortbewegungsmittels, ist es unstrittig ein Pionierwerk dieser Gattung, der Eisenbahnbrücken. Dies allein würde genügen, ihm eine besondere Stellung einzuräumen.
In diesem Fall lässt sich die Bedeutung um eine weitere Dimension erweitern, eine Frage von übergeordneter Tragweite: Ist der Viadukt sogar das Werk Georg Mollers, des prominenten hessischen Oberbaudirektors Georg Moller – und rückt damit in die höheren Sphären der Architekturgeschichte auf? Eine umso größere Bedeutung nimmt diese Frage an, als sich nicht mehr viele originale Bauten aus Mollers hochkarätigem Oeuvre erhalten haben.
Diese Verbindung ist bereits von Peter Schubert 1995 in seinem Buch „Der Viadukt“ gezogen worden, worin das besondere Objekt erstmals ausführlich vorgestellt wird, seine Geschichte und sein Kontext beleuchtet werden. Die darin zusammengestellten Informationen, Quellen und Deutungen bilden die Grundlage für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Baudenkmal selbst wie auch zur Frage der Autorenschaft.
Hinzu tritt ein neues Interesse an Georg Moller, vor allem aus der Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft heraus, deren Namensgeber Mollers Lehrer in Baden gewesen war – und dessen Mentor, Freund, Vorbild. Im 2023 erschienenen Buch „Georg Moller. Werk & Netzwerk“ leitet der Vorsitzende Ulrich Maximilian Schumann aus dem erhaltenen Briefwechsel an Georg Moller eine umfassende Deutung von dessen Werk ab, die um genau diese Vernetzung kreist. Damit wird gezielt Mollers Stellung in seinem beruflichen und gesellschaftlichen Netzwerk beleuchtet, in der Bauverwaltung und den Abläufen von Entwurf und Durchführung, als Entwerfer und als Baubeamter, mithin in jenen Spannungsfeldern, in denen der Rosental-Viadukt Gestalt und Bedeutung annahm.
Netzwerk am Rosental-Viadukt
Selbst wenn man Georg Moller vorerst noch ausklammert, stellt sich dieser Brückenbau als Gemeinschaftswerk dar, denn es waren mehrere Personen in die Verantwortung eingebunden.
Als dessen Entwerfer wird in der Regel der Name Peter Hochgesand genannt. Denn er reichte die Pläne ein. Er war mit nicht einmal dreißig Jahren ein noch junger, wenig erfahrener Architekt. Seine Biographie ist durch Peter Schubert in oben genanntem Buch rekonstruiert worden. Erst Ende 1842 hatte Hochgesand seine Prüfung im Baufach abgelegt und danach in Kreisbauverwaltungen hospitiert.
Die Pläne für den Rosental-Viadukt erarbeitete er als Ingenieur an der Main-Weser-Bahn, wozu er kurz zuvor, 1846, ernannt wurde. Nach dem Bau des Rosental-Viaduktes entwarf er offenkundig nichts mehr. Seine Laufbahn war eher diejenige eines Organisators – als Mitglied der Bahnverwaltungen in Friedberg, Gießen, Darmstadt und Mainz.
Damit ähnelte seine Karriere derjenigen weiterer Mitglieder der hessischen Bauverwaltung unter Georg Moller, wie sie sich immer wieder im erwähnten Briefwechsel spiegeln. Unterzeichnet, mithin genehmigt, wurden die Pläne für den Rosental-Viadukt durch Carl Müller, der eine ähnliche Laufbahn absolvierte wie Peter Hochgesand. In den 1830er Jahren Kreisbaumeister in Gießen, amtete er dort im folgenden Jahrzehnt als übergeordneter Provinzialbaumeister und leitete zugleich die dortige oberhessische Eisenbahn-Baudirektion.
Ist also mit diesen beiden Namen die Urheberschaft des monumentalen Industriebauwerks hinreichend belegt?
Bei Hochgesand müsste zunächst erstaunen, wie der junge Architekt in der Lage gewesen sein soll, fast aus dem Stand dieses monumentale Werk bis in die konstruktiven Feinheiten hinein zu entwerfen und durchzuführen. Gewiss war er sorgfältig an der Schnittstelle zwischen Architektur und Ingenieurwesen ausgebildet worden, zunächst für zwei Jahre im Bureau des Mainzer Kreisbaumeisters Ignaz Opfermann, Schüler Friedrich Weinbrenners und Architekt von Bahnbauten und -strecken, und danach des obersten hessischen Landesarchitekten Georg Moller, bevor er unter diesem in die Landesbauverwaltung eintrat. Die für ein so großes Projekt erforderliche Erfahrung konnte Hochgesand jedoch naturgemäß nicht nachweisen.
Doch war dies im System der hessischen (wie auch schon der badischen) Bauverwaltung nicht notwendig, denn alle Ebenen arbeiteten eng, ja symbiotisch zusammen. Auch Hochgesands unmittelbarer Vorgesetzter Carl Müller berichtet 1832 in dem erwähnten Briefwechsel, wie der Oberbaudirektor Moller in Darmstadt Pläne für Brücken erarbeitete, die vom örtlichen Provinzialbaumeister kommentiert, angepasst, wiederum von Moller korrigiert und schließlich unter Müllers Aufsicht vor Ort umgesetzt wurden. (Georg Moller. Werk & Netzwerk, Brief 67, S. 125) Auch Letzterer war demnach an die übergeordnete Instanz gebunden, konnte keine Pläne eigenmächtig erstellen. Dies war keine Frage von Hierarchie, gar Eitelkeit oder ‚romantischem Geniekult‘, sondern von effizienter Aufgabenverteilung, Qualitätssicherung und gegenseitiger Wertschätzung. Soviel können wir aus unserer Kenntnis dieses Umfeldes als sicher voraussetzen.
Dieses kollegiale Verhältnis auf Augenhöhe zwischen Lehrer und Schüler oder Mitarbeiter ist geradezu ein Markenzeichen der Bauausbildung und -verwaltung unter Georg Moller. So hatte er es schon bei seinem eigenen Lehrer Friedrich Weinbrenner erfahren, dessen loyaler Schüler Moller stets blieb und der diesen in Briefen als „Freund“ anredete, und führte es in seiner eigenen, vergleichbaren Laufbahn weiter.
Hinzu kam der praktische Umstand, dass alle Bauvorhaben im Land ohnehin über den Schreibtisch des Oberbaudirektors gingen, in Baden wie in Hessen, und sich dabei mehr oder weniger tiefgreifend verändern konnten, weshalb oft nicht eindeutig auszumachen ist, wer letztlich welchen Anteil am Entwurf hatte und als wessen Werk es anzusprechen ist. So drängelte beispielsweise der berühmte Chemiker Justus Liebig 1839 in einem Brief Georg Moller als oberste Instanz im hessischen Bauwesen zur Begutachtung bzw. Korrektur der Pläne zu seinem Laboratorium an der Gießener Universität, die vom Provinzial- und Universitätsbaumeister Johann Philipp Hofmann betreut wurden.
In mehreren weiteren Briefen lässt sich nachvollziehen, wie Georg Moller seine Schüler, aber auch Mitarbeiter und Kollegen nach deren Abschluss weiterhin uneigennützig berät, in allgemeinen Fragen wie bei konkreten Projekten, auch bei solchen, die letzlich nicht seine Unterschrift trugen. So enthüllen zum Beispiel erst die Briefe von Georg Laves an Moller, dass dieser in die Entwicklung des „Laves-Trägers“, eines vor allem für Brücken verwendeten Fischbauchträgers, ebenso eingebunden war wie in den Entwurf zum Wangenheim-Palais in Hannover.
Auch wenn er wegen seiner Architektur im stilistischen Spannungsfeld zwischen Klassizismus und Romantik bekannt war und sich nicht als Ingenieur bezeichnete, war Georg Moller – wiederum wie sein Lehrer Friedrich Weinbrenner – zugleich ein vielbewunderter Konstrukteur, der sein Wissen großzügig und selbstlos weitergab.
In seiner Beispielsammlung „Beiträge zu der Lehre von den Construktionen“ (1832–44) veröffentlichte er selbst ein konkretes Vorbild für den Rosental-Viadukt, das er 1840–43 mit dem Göhltal-Viadukt an der Eisenbahnstrecke zwischen Aachen und Lüttich gegeben hatte, ein Pionierwerk dieser Bauaufgabe mit einer Länge von 220 Metern und Höhe von 40 Metern. Bei beiden Brücken handelt es sich um vergleichbare Konstruktionen auf Rundbögen, wenngleich im Göhltal aus gebrannten, nicht natürlichen Steinen.
Der Auftrag zum außerhalb Hessens gelegenen Göhltal-Viadukt erging an Moller entsprechend nicht als hessischen Landesarchitekten, sondern als überregional bekannten Konstrukteur und wohl auch als Verwandten von David Hansemann, Vorstand der Rheinischen Eisenbahngesellschaft. Doch selbst in diesem Fall blieb sein Name weitgehend im Hintergrund, ist kaum bekannt im Zusammenhang mit diesem wegweisenden, seit dem Zweiten Weltkrieg zerstörten Bauwerk.
Noch ein weiterer Faktor muss hier beachtet werden: Die endlos erscheinende Reihe von überlängten Rundbögen ist nicht nur ein konstruktives Element, sondern ein architektonisches Motiv, das eine perspektivische Sogwirkung entfaltet. Gerade für Moller besaß es eine herausragende Bedeutung, denn seine Karriere begann genau damit noch im Bureau seines Lehrers Weinbrenner; für ihn zeichnete er 1806 das berühmt gewordene, viel veröffentlichte Schaubild für dessen wohl folgenreichstes Projekt, die geplante Umgestaltung der Langen Straße in Karlsruhe. Vor die verschiedenartigen Fassaden der bestehenden Häuser hätten die dreigeschossigen Rundbögen eine zusätzliche räumliche Dimension gelegt und zugleich die Straße als Raum sichtbar gemacht. (Friedrich Weinbrenner. Worte und Werke, 2017, S. 290–294) Für den Architekten mehr als für den Ingenieur ist ein Viadukt nicht nur die Verbindung zwischen zwei Punkten, sondern selbst ein raumhaltiges Gebäude. (Georg Moller. Werk & Netzwerk, S. 43/44) Dies gilt für den Göhltal-Viadukt in gleichem Maße wie für den Rosental-Viadukt, der sogar als „24 Hallen“ wahrgenommen und bezeichnet wird.
Dieser Aspekt ist insbesondere in Mollers unmittelbarem Umfeld bedeutungsvoll und sogar prägend, entstammt er als Architekt doch der Weinbrenner-Schule, in der erstmals in der Geschichte der Raum in das Zentrum des Entwerfens gestellt, die Architektur als die Kunst des Räumeschaffens beschrieben wurde. Dass er diese moderne Sichtweise übernimmt und weiterführt, ist in der Einführung in die Briefedition belegt wurde. (Georg Moller. Werk & Netzwerk, S. 33–47)
Fazit
Diese unterschiedlichen Aspekte zusammengenommen, erscheint eine zentrale Rolle Georg Mollers an der Entstehung des Rosental-Viaduktes nicht nur höchst wahrscheinlich, sondern sogar unumgänglich.
An dieser Stelle muss der Rahmen noch einmal weiter gezogen werden: Privatarchitekten gab es damals noch nicht, die auf eigene Rechnung arbeiteten und sich mit ihren Entwürfen für weitere Aufträge empfehlen mussten. Alle Bauten entstanden innerhalb einer Bauverwaltung, weshalb es eine untergeordnete Rolle spielte, wessen Name unter den Plänen stand. Eigenständige Entwürfe ohne Einbeziehung der übergeordneten Instanz, in diesem Fall der hessischen Baudirektion in Darmstadt, waren nicht vorgesehen und nicht notwendig. Entscheidend war das gemeinsame Ergebnis.
Die Unterschrift auf einem eingereichten Entwurf bedeutet nicht, diesen als das eigene Werk zu kennzeichnen, sondern die Verantwortung im bürokratischen Verkehr zu übernehmen – weniger nach außen als nach innen.
Architekten erlangten typischerweise Bekanntheit, indem sie in ihrer Studienzeit begannen, mit überzeugenden Entwürfen oder Rekonstruktionen auf sich aufmerksam zu machen, sich an den künstlerischen und gesellschaftlichen Diskursen beteiligten, Schriften veröffentlichten oder selbst in Journalen erwähnt wurden, auch intensiv durch Briefe kommunizierten, um durch solche indirekten oder auch direkte Empfehlungen im besten Fall eine Position zu erwerben, in der sie den architektonischen Ausdruck für das jeweilige Land erarbeiten konnten, gemeinsam mit den anderen Akteuren und im Einklang mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
So verlief es geradezu idealtypisch für Georg Moller, der nach intensiven praktischen und theoretischen Auseinandersetzungen mit dem eigenen Beruf den hohen Standard, der im hessischen Bauwesen erreicht wurde, federführend entwickelte, garantierte und nach außen wie innen repräsentierte. In diese Welt fügt sich der Rosental-Viadukt nahtlos ein, der in technischer wie ästhetischer Hinsicht diesen Standard erfüllte.
Die Förderung junger Mitarbeiter gehörte zum Auftrag und Selbstverständnis der Moller-Schule. Dazu gehörte auch, dass ihnen der Oberbaudirektor Freiräume einräumte, damit sie sich in die verschiedenen Bereiche des Bauens einüben konnten. Einem Berufsanfänger wie Peter Hochgesand den besonders umfangreichen und diffizilen Entwurf zum Rosental-Viadukt zu überlassen, musste jedoch unverantwortlich erscheinen. Dafür stand zu viel auf dem Spiel, im Besonderen das Leben der darauf reisenden Passagiere.
Auch wenn wie häufig in jener Zeit die erhaltenen Dokumente die komplexen Bauprozesse nur lückenhaft wiedergeben und in diesem Fall auf den hierin wenig erfahrenen Peter Hochgesand hindeuten, ergibt sich aus der Betrachtung des Umfeldes der plausiblere Schluss, dass der ausgeführte Entwurf zu diesem außergewöhnlichen Bauwerk im Bureau Georg Mollers entstanden sein muss, wie derjenige zum Göhltal-Viadukt, federführend durch ihn selbst, aber freilich im Zusammenspiel mit architektonisch wie technisch ausgebildeten Spezialisten um ihn herum und den Baubeamten vor Ort.